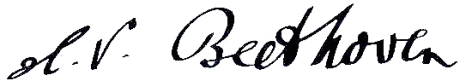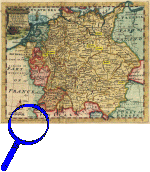|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
1770 |
Ludwig van Beethoven wird am 17. Dezember in seinem
Geburtsort Bonn* getauft. Sein Geburtstag steht nicht fest, ist aber
wahrscheinlich der 16.12.1770.
*Die in Farbe markierten Städte sind auf der Karte zu finden. Er ist das erste überlebende Kind von Maria Magdalena vB, geb. Keverich, und Johann vB, einem schlecht bezahlten Hofmusiker (Tenorist und Violinist) in der Bonner Residenz von Maximilian Friedrich, Kurfürst und Erzbischof von Köln. Der Name van Beethoven deutet auf die Herkunft der Familie aus dem heute belgischen Flandern; das Prädikat »van« ist kein Adelstitel. Schon sein Grossvater, Ludwig vB der Ältere, war ein respektierter Sänger (Bassist) am gleichen Hofe, mit kärglichem Gehalt selbst nachdem er Kapellmeister geworden war, aber mit Nebeneinkünften von Weinhandel und anderen Geschäften. |
|
1773 |
Tod des geliebten Grossvaters. | |
1775 |
Musikunterricht vom strengen Vater; zum Klavierspielen muss der Kleine auf einem Bänkchen stehen. Es gibt noch keine Schulpflicht und weil seine Eltern ihn nicht regelmässig zur Schule schicken, wird LvB während seines ganzen Lebens hauptsächlich an einem Mangel mathematischen Grundwissens leiden. | |
1778 |
Erster Auftritt LvBs in seiner relativ kurzen Karriere als »Wunderkind« in Köln, noch vor seinem achten Geburtstag, mit einem Programm von Klaviermusik. Sein Talent zur Improvisation ist bereits bekannt. | |
1782 |
Veröffentlichung von Ludwigs ersten Kompositionen, den
c-moll Variationen über einen Marsch von Dressler (WoO 63*) bei Götz,
einem Mannheimer Verleger, auf Veranlassung seines Lehrers Christian Gottlob
Neefe. Von ihm erhält er Unterricht, u.a. im Generalbass, und er vertritt
ihn auch schon als Organist in der Bonner Hofkapelle.
*Beethoven erteilt Opus-Zahlen nach der Bedeutung seiner Werke und nach Kriterien, die wir nicht kennen, jedenfalls nicht chronologisch. Etwa die Hälfte seiner Kompositionen bleibt ohne Opus-Zahl und wird daher in der Literatur so bezeichnet (WoO = Werk ohne Opus-Zahl). |
|
1783 |
Neefe berichtet über das virtuose Klavierspiel des jungen Beethoven im Hamburger Magazin der Musik und erwähnt dessen Vorliebe für das Wohltemperirte Clavier von Johann Sebastian Bach. Veröffentlichung von drei Klaviersonaten (WoO 47). | |
1784 |
Beethoven erhält vom neuen Kurfürst Maximilian Franz, dem
Nachfolger von Maximilian Friedrich, die besoldete Stelle eines
stellvertretenden Hoforganisten. Ausser den Tasteninstrumenten spielt er
auch Bratsche, Violine und Cello. Sein Gehalt erleichtert die immer schlimmeren Geldnöte der Eltern und der beiden jüngeren Brüder Caspar Anton (*1774) und Nikolaus Johann (* 1776). Der Vater verliert Stimme und berufliches Ansehen und ergibt sich zunehmend dem Alkohol. |
|
1786 |
Der Zeichner Johann Peter Lyser berichtet von einem Besuch bei Freunden in diesem Jahr, wobei er zum ersten Mal LvBs Gehörschwierigkeiten bemerkt habe. | |
1787 |
Im Frühjahr begibt sich LvB auf eine Studienreise nach Wien, muss aber nach etwa drei Wochen wegen einer schweren Erkrankung der Mutter wieder nachhause fahren. Seine Mutter stirbt im Juli an Tuberkulose; im November folgt ihr seine kleine Schwester Maria Margaretha (*1786). | |
1789 |
LvB immatrikuliert sich an der Universität
Bonn. Er besucht
wahrscheinlich – aber wahrscheinlich nicht regelmässig – Vorlesungen über
Philosophie, Ästhetik und Literatur und erwirbt eine grundlegende Bildung,
auf die er stolz ist. Er ist belesen und kennt z.B. Goethes Die Leiden des
jungen Werther (veröffentlicht 1774) und die erste Version von Schillers
Ode an die Freude (veröffentlicht 1785). Auf Ludwigs Antrag verfügt der Kurfürst, dass die Hälfte des väterlichen Gehalts von nun an dem Hoforganisten Ludwig van Beethoven auszuzahlen sei. Der Vater wird vorzeitig in den Ruhestand versetzt, der Sohn wird offiziell Oberhaupt der Familie. |
|
1792 |
LvB unternimmt mit Hilfe eines Stipendiums des Kurfürsten
eine Studienreise nach Wien, damals eines der musikalischen Weltzentren, mit
der Absicht, bei Joseph Haydn zu studieren. Sein Freund Ferdinand Graf
Waldstein schreibt ihm zum Abschied die berühmten Worte ins Stammbuch:
»Durch ununterbrochenen Fleiss erhalten Sie: Mozart’s Geist aus Haydens
Händen. Bonn 29. 10. 1792«.
Beethoven zieht in ein Zimmer im Dachgeschoss des Hauses, in dem Fürst Karl v. Lichnowsky eine Etage bewohnt. Der reiche Besitzer von Ländereien in Schlesien ist ein vorzüglicher Pianist, hat bei Mozart Unterricht genommen und unterhält ein Streichquartett, dessen erster Geiger, Ignaz Schuppanzigh, sich bald mit Beethoven anfreundet. Ein paar Wochen nach Ankunft in Wien erhält Ludwig van Beethoven die Nachricht, dass sein Vater Johann im Alter von etwa 52 Jahren verstorben ist. |
|
1793 |
Der Bonner Professor der klassischen Literatur Ludwig
Fischenich schreibt an Charlotte Schiller, LvB beabsichtige, Friedrich
Schillers Ode an die Freude zu vertonen (sie wird schliesslich 1823 zum
pinzipiellen Thema im Schlusssatz der 9. Symphonie).
Beethoven macht durch sein virtuoses Klavierspiel bald die Bekanntschaft vieler der besten Musiker im musischen Wien und kommt schnell in die gesellschaftlich höchsten Kreise. Mit dem von ihm nachlässig genannten Unterricht Haydns ist er nicht zufrieden, und so nimmt er, hinter dessen Rücken, Stunden im Tonsatz bei Georg Albrechtsberger, lässt sich von Schuppanzigh im Violinspiel weiterbilden, und von Antonio Salieri im modernen italienischen Musikstil unterweisen. Eine seiner Klavierschülerinnen beschreibt ihn als klein und unscheinbar (er war etwa 1,68 m gross), mit hässlichem pockennarbigen Gesicht und dunklem Haar, und er kleide sich nicht, wie man es in der besseren Gesellschaft gewohnt sei. Jedenfalls trägt Beethoven nie eine Allongeperücke wie zum Beispiel Haydn. |
|
1794 |
Fürst Lichnowsky wird einer seiner besten Freunde und unterstützt ihn mit einem grosszügigen Einkommen, nachdem Kurfürst Maximilian Franz mit der Besetzung Bonns durch die Franzosen seine Gehaltszahlungen einstellt. | |
1795 |
Beethoven ist ausserordentlich fleissig. Er komponiert eine
grosse Zahl bedeutender Werke, spielt häufig auf Fürst Lichnowskys Soireen,
erhält immer mehr Einladungen und fängt an, ein sehr gutes Einkommen als
freischaffender Künstler zu verdienen. Seine Brüder Caspar und Nikolaus
ziehen ebenfalls nach Wien. In dieser Zeit fällt wohl sein Entschluss, für
immer in Wien zu bleiben. Beim ersten öffentlichen Auftreten in Wien am 29. März spielt Beethoven sein Klavierkonzert in C, op. 15. |
|
1796 |
Reise nach Prag (Prague), Dresden, Berlin und Leipzig (Leypzig). | |
1798 |
Ab diesem Jahr häufen sich die Bemerkungen von Freunden und
Bekannten über Anzeichen LvBs zunehmender Schwerhörigkeit. Er selbst beklagt
sich über »Sausen und Brausen« in den Ohren und periodisch auftretende
Ohrenschmerzen. Entstehung (unter vielen anderen Werken) der Sonate pathétique, in c-moll, op. 13. |
|
1800 |
Am 2. April kommt Beethovens 1. Symphonie (in C, op. 21) im Wiener Burgtheater zur Uraufführung. Noch vor Vollendung seines dreissigsten Lebensjahres hat er sich damit als freischaffender Künstler etabliert und ist sogar gefeiert als Virtuose, genialer Improvisator und Komponist. | |
1801 |
LvB schreibt seinem Jugendfreund, dem Arzt Franz Gerhard Wegeler, von seinem Gehörleiden und fragt ihn, ob er etwas vom »Galvanism« halte, also von einer damals neumodischen Behandlung aller möglicher Leiden mit elektrischem Strom. | |
1802 |
Beethoven verfasst bei einem Sommeraufenthalt in
Heiligenstadt, einem Dorf bei Wien, das sog. Heiligenstädter Testament.
Er adressiert es an seine Brüder, schickt es aber nicht ab; es findet sich
erst in den Papieren seines Nachlasses. Er entschuldigt darin seine schroffe
Art mit dem »heillosen Zustand« seiner Taubheit, schreibt, dass nur die
Kunst ihn davon abgehalten habe, sich das Leben zu nehmen, dankt seinen
Freunden und seinem Arzt, versichert, dass er sein »elendes Leben« bis zum
natürlichen Tod fristen wolle, und vermacht sein »kleines« Vermögen den
Brüdern. Das Testament ist also nicht der Abschiedsbrief eines
potentiellen Selbstmörders.
Die Mondscheinsonate (in cis-moll, op. 27) entsteht. Beethoven widmet sie der siebzehnjährigen Comtesse Giulietta Guicciardi, einer seiner Klavierschülerinnen, bei deren Familie er zeitweilig gern gesehener Logiergast ist. Scherzkomposition Lob auf den Dicken für den Freund und hervorragenden Violinisten Ignaz Schuppanzigh. |
|
1803 |
Erstaufführung (u.a.) der 2. Sinfonie (in D, op. 36), des 3. Klavierkonzerts (in c-moll, op. 37) und der Klaviersonate in A, op. 47, später dem Geiger Rodolphe Kreutzer gewidmet und daher mit dessen Namen bekannt. | |
1805 |
Beethoven umwirbt die verwitwete Josephine Brunswick-Deym.
Erste öffentliche Aufführung der 3. Symphonie, in Es, op.55 (»Eroica«) und der Oper Fidelio (op. 72) in ihrer ersten Fassung, beide im Theater an der Wien. Der Fidelio wird vom Publikum sehr kühl aufgenommen. Häufige Darmkoliken, denen Mineralwässer und Badekuren ohne eine geregelte Diät keine Besserung bringen. Der Bühnendichter Franz Grillparzer beschreibt 1844 den Künstler in seinen »Erinnerungen an Beethoven« als »damals noch mager, höchst elegant gekleidet« und Brillenträger. |
|
1806 |
Komposition von drei Streichquartetten, op. 59, für Graf (später Fürst) André Rasumowsky, den russischen Gesandten am Wiener Hof, einen guten Geiger. | |
1807 |
Zu dieser Zeit ändert sich Beethovens Erscheinung. Laut Grillparzer ist er in den vergangenen zwei Jahren stärker geworden und geht »höchst nachlässig, ja unreinlich gekleidet«. | |
1808 |
Ein Panaritium (eine vereiterte Entzündung) an einem Finger der linken (?) Hand wird erfolgreich operativ behandelt und behindert Beethoven zum Glück nicht bleibend beim Klavierspielen. | |
1809 |
Beethoven geht wegen seiner »Gedärmentzündung« und der zunehmenden Taubheit durch tiefe Krisen mit wiederkehrenden Selbstmordgedanken. Trotzdem hofft er, eine Ehegefährtin zu finden. Er verliebt sich in die neunzehnjährige Therese Malfatti, die Nichte seines Hausarztes, bestellt neue Anzüge und Hemden und legt also wieder etwas mehr Wert auf sein Äusseres. | |
1810 |
LvB bittet einen seiner Freunde in
Bonn, ihm doch einen
Taufschein zu schicken; offensichtlich hat er die ernsthafte Absicht,
Therese zu heiraten. Leider weist sie ihn ab.
Die temperamentvolle und fröhlich exaltierte Bettina Brentano, die schon Johann Wolfgang Goethe durch ihre Intelligenz aufgefallen war – und die er später lästig fand –, sucht die Nähe Beethovens und es gibt Hinweise dafür, dass er sich für sie interessiert. |
|
1811 |
Kuraufenthalt in Teplitz, nordwestlich von Prag (heute Teplice, Tschechien). Vorübergehende Besserung der Ohrenschmerzen. | |
1812 |
Erneut Badekuren in Teplitz und anderen Kurorten. Mehrere
Begegnungen mit Johann Wolfgang Goethe, der Beethoven seit der gelungenen
Vertonung seines Dramas Egmont bewundert (»Sein Talent hat mich in
Erstaunen gesetzt«), ihn aber doch für eine »ganz ungebändigte
Persönlichkeit« hält.
Im Juli schreibt Beethoven einen der bestbekannten Liebesbriefe der deutschen Literatur, den Brief an die unsterbliche Geliebte. Er nennt die Dame nicht beim Namen und ihre Identität bleibt bis heute ein Rätsel. Die weitverbreitete Büste LvBs wird von Franz Klein nach einer Lebendmaske geformt und gilt als zuverlässiges Zeitzeugnis. |
|
1813 |
Keines einer Vielfalt von Hörrohren hilft Beethoven. Seine
Suche nach einem wirksamen Apparat zeigt, wie tief schwerhörig er ist und
dass er fast an seinem Leiden verzweifelt: er hält zum Beispiel beim
Klavierspielen einen dünnen Holzstab zwischen den Zähnen, der, an den
Resonanzboden des Flügels gedrückt, ihm die angeschlagenen Töne durch
Knochenleitung vermittelt.
Seine Kompositionen zeigen immer noch die Musikalität des Genies, Kraft und Ausdrucksstärke, aber seine Virtuosität am Klavier verfällt. Am 8. Dezember kommt sein Schlachtengemälde Wellingtons Sieg (op. 91) zur Uraufführung und wird zum grössten Publikumserfolg seiner Kompositionen während er lebt. Beethovens finanzielle Lage ist schlecht, obwohl er ausreichende oder sogar gute Einkünfte hat. Sein Hauswesen ist ungeordnet bis unordentlich. Er ist schroff und abweisend im Umgang; des öfteren bezichtigt er seine Hausangestellten der Unehrlichkeit. Seine Menschenscheu und sein Misstrauen sind gewiss zu hohem Grade mit seiner Gehörlosigkeit zu erklären. Fürst Ferdinand Bonaventura Kinsky stirbt, einer seiner Freunde und Gönner aus den adligen Kreisen, die Beethoven seit Jahren eine Apanage zukommen lassen. |
|
1814 |
Auch der allererste seiner Mäzene, Fürst Karl v. Lichnowsky, stirbt. Er war seit Beethovens Ankunft in Wien mit ihm befreundet gewesen. | |
1815 |
Der Wiener Kongress berät über die Neuordnung Europas nach
den Napoleonischen Kriegen. Beethoven begrüsst das neue Europa mit der
freudig optimistischen Kantate (op. 136) Der glorreiche Augenblick.
Zu Ehren der Zarin gibt er am 25. Januar ein Konzert; es ist sein letztes.
Gegen Ende des Jahres verstirbt Ludwigs jüngerer Bruder Caspar Anton, genannt Carl, der ein beliebter und tüchtiger Musiklehrer geworden war. Beethoven wird Vormund seines Neffen Karl, gemeinsam mit dessen Mutter Johanna. Die Witwe droht das Vermögen ihres verstorbenen Gatten schnell zu erschöpfen, und daher wird LvB in einen langjährigen Rechtsstreit verwickelt, der seine Kräfte sehr beansprucht. Bei allem lässt er Karl gewissenhaft ausbilden, besonders in Musik, u.a. von seinem ehemaligen Schüler Karl Czerny. |
|
1817 |
Da Beethoven immer noch keine Besserung seiner Leiden
feststellen kann, wird er unzufrieden mit seinem behandelnden Arzt Johann
Malfatti. Allerdings hält er sich auch kaum an ärztliche Verordnungen.
Er trinkt etwa 1 Liter »Tischwein« am Tag, eine Menge, die zu dieser Zeit nicht für exzessiv gehalten wird. Die Ernährungsvorschriften der Malfatti nachfolgenden Ärzte verbieten ihm jeglichen Alkoholkonsum. |
|
1819 |
Ab Januar benutzt Beethoven Konversationshefte, d.h. eine
Unterhaltung mit ihm wird zum Teil schriftlich geführt dadurch, dass
Besucher ihre Fragen und Äusserungen aufschreiben. LvBs Antworten oder
Beiträge sind natürlich nicht erhalten. Etwa 120 dieser Hefte existieren
noch.
Im wesentlichen Arbeit an der im vorherigen Jahr begonnenen Missa solemnis. |
|
1821 |
Beethoven erkrankt anfangs Juli an der Gelbsucht, bei der
Leberzellen durch Einwirkung toxischer Stoffe oder durch Infektion zerstört
werden und dadurch ein gelbes Stoffwechselprodukt des Blutfarbstoffs
Hämoglobin in der Haut abgelagert wird. Erst im November erholt er sich
wieder einigermassen, um »... wieder neu auf für meine Kunst zu leben, welches
eigentlich seit zwei Jahren nicht der Fall ...«
Seit der Gelbsucht bleibt seine Haut gelblich, was auf ein chronisches Leberleiden, d.h. eine Leberzirrhose, schliessen lässt. |
|
1822 |
Die berühmte Sopranistin Wilhelmine Schröder-Devrient
schreibt in ihren Erinnerungen, dass Beethoven auf der Generalprobe des
Fidelio im November als Dirigent »verwirrten Antlitzes, mit überirdisch
begeistertem Auge« Chor und Orchester völlig aus dem Takt und in Konfusion
brachte, und wie herzzerreissend es war, ihn bei der Aufführung resigniert
hinter dem Orchester sitzen zu sehen. Diesmal ist der Fidelio ein
grosser Erfolg.
Anton Schindler wird Beethovens Sekretär und Faktotum. Er erhält kein Gehalt für seine Dienste und wird von LvB zeitweise recht schlecht behandelt, z.B. bezichtigt, Geld aus einer Aufführung unterschlagen zu haben. Schindler wird 1840 eine Biographie Beethovens veröffentlichen, die allerdings eine Zahl von nachgewiesenen Unrichtigkeiten enthält. |
|
1823 |
Die Missa solemnis (op. 123) und die
Diabelli-Variationen (in C, op. 120) werden fertig. Beethoven leidet vom Anfang des Jahres bis in den späten August an einer schmerzhaften Bindehautentzündung beider Augen. |
|
1824 |
Uraufführung von Kyrie, Credo und Agnus Dei der Missa solemnis und der Neunten Symphonie (in d-moll, op. 125) im Kärntnertor-Theater in Wien. Der Komponist kann den rauschenden Beifall nicht mehr vernehmen.. | |
1825 |
Ludwig van Beethovens Biographie wird von jetzt an fast ausschliesslich zu einer Krankengeschichte. Seine Gesundheit wird immer schlechter. Die chronischen Verdauungsstörungen machen ihm sehr zu schaffen, er hat häufig Darmkoliken und Durchfälle, und er berichtet von blutigem Stuhl und blutigem Sputum. Alle diese Symptome sind wahrscheinlich die Folge seiner chronischen Lebererkrankung. Dazu kommen immer noch sein Augenleiden und neuerdings Gichtschmerzen, die ihm das Gehen schwer machen. | |
1826 |
Beethoven besucht im November bei sehr schlechtem Wetter
seinen Bruder Johannes, einen erfolgreichen Apotheker und reichen
Grossgrundbesitzer, auf seinem Gut in Krems an der Donau. Dieser vermerkt in
seinem Tagebuch, dass Ludwig einen auffällig geschwollenen Bauch habe.
Auf der Rückfahrt vom Besuch seines Bruders erkältet er sich stark, er bekommt Fieber, Schüttelfrost und Seitenstechen, und er tut sich schwer beim Atmen. Sein behandelnder Arzt, jetzt Prof. Ignaz Andreas Wawruch, stellt die Diagnose einer Lungenentzündung und behandelt diese damals sehr oft tödliche Krankheit mit Erfolg. Beethovens geschwollener Bauch kommt von einer Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum. Der Verlust von funktionellen Leberzellen, Jahre zuvor mit der Gelbsucht begonnen, führt zu einer Vernarbung der Leber, also zu einer Leberzirrhose. Diese wieder hat eine starke Minderung des Blutflusses in den der Leber zuführenden Blutgefässen zur Folge; es kommt zu einer Stauung des Blutes, dann zu einem Austritt von Flüssigkeit durch die Gefässwände, schliesslich zur Ansammlung dieser Flüssigkeit, einem sog. Ascites. Professor Wawruch punktiert den Bauchraum mehrmals und entleert einmal ein Volumen von 25 Pfund Gewicht (also etwa 13 kg!). Diese symptomatische und ohne Anästhesie durchgeführte Behandlung bringt nur eine jeweils kurzzeitige Erleichterung. |
|
1827 |
Am 3. Januar verfasst Beethoven sein Testament. Er setzt
seinen Neffen Karl zum Universalerben ein.
Am 25. März verliert Ludwig van Beethoven das Bewusstsein. Er stirbt im Leberkoma am 26. März gegen 17.45 Uhr, in seinem 57. Lebensjahr. Die Obduktion findet am folgenden Tage statt. Die Beerdigung erfolgt am 29. März im Währinger Friedhof. Franz Grillparzer spricht die Worte am Grab. |
|
1863 |
Erste Exhumierung Beethovens zur pathologischen Untersuchung. Seine sterblichen Reste werden in einem Metallsarg beigesetzt. | |
1888 |
Zweite Exhumierung der sterblichen Reste Beethovens und Überführung und Überführung in ein Ehrengrab im Zentralfriedhof der Stadt Wien. | |
|
Das in Latein abgefasste Protokoll der Leichenöffnung wurde 1970 unter alten Akten wiederentdeckt. Es bietet ein für eine Leberzirrhose typisches Erscheinungsbild; der Sektionsbefund erlaubt die moderne Diagnose. Die direkte Todesursache ist Leberversagen bei Leberzirrhose. Zur Untersuchung des Gehörorgans wurden bei der Obduktion auf beiden Schädelseiten Teile des Schläfenbeins entnommen und konserviert. Diese Knochenfragmente wurden von einer Wiener Familie, den Nachkommen eines Professors der Medizingeschichte, als Reliquien betrachtet, aber 1985 den Professoren Dr. med. Hans Bankl und Dr. med. Hans Jesserer der Universität Wien zur Untersuchung übergeben. Diese Wissenschaftler veröffentlichten 1987 ein Buch über Beethovens Erkrankungen und kamen u. a. zu dem Schluss, dass die Schwerhörigkeit Beethovens nicht wie häufig vermutet die Folge einer Pagetschen Knochenerkrankung war. Eine Schwerhörigkeit als Folge einer Syphilis wurde ebenfalls ausgeschlossen. Die Autoren erklären vielmehr die Taubheit als die Konsequenz eines relativ seltenen Innenohrtyps der Otosklerose, bei welcher Erkrankung die den Hörnerven begleitenden Blutgefässe geschädigt sind und der Nerv langsam atrophiert. Diese Diagnose deckt sich völlig mit den Symptomen und dem Verlauf von Beethovens Gehörschwierigkeit. Zur Kurzsichtigkeit Beethovens: die Messung der Brechkraft zweier seiner Brillen, eines Monokels und einer Leselupe ergab Werte von - 1.75 bis - 4.0 Dioptrien. Der genaue Grad seiner Myopie lässt sich nicht ermitteln, da man nicht weiss, in welchem Alter Beethoven diese Brillen benutzt hat und sowohl eine Besserung wie eine Verschlechterung der Sehstärke mit zunehmendem Alter möglich sind. Eine bemerkenswerte Nebensächlichkeit: Beethoven hatte bei seinem Tod noch alle seine Zähne, damals eine Seltenheit. |
||
Empfohlene Literatur |
||
|
Bankl, Hans; Jesserer, Hans: Die Krankheiten Beethovens. Verlag Wilhelm Maudrich, Wien: 1987 Beethoven Bicentennial Collection (Schallplatten) George G. Daniels, ed., Time Inc., New York: 1972 Geck, Martin: Ludwig van Beethoven. Rowohlt-Verlag, Reinbek, 5. Aufl.: 2001 Grillparzer, Franz: Sämtliche Werke. Carl Hauser, München: 1965, Bd. IV, pp. 195–203 Kaiser, Joachim: Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpreten. S. Fischer, Frankfurt/Main: 1975 Kinsky, Georg; Halm, Hans: Thematisch-Bibliographisches Verzeichnis aller vollendeten Werke Ludwig van Beethovens. G. Henle, München: 1955/83 Schindler, Anton: Biographie von Ludwig van Beethoven. Faksimile-Nachruck der Ausgabe von 1871. Georg Olms Verlag, Hildesheim: 1994 Schmidt, Leopold: Beethoven, Werke und Leben. Wegweiser-Verlag, Berlin: 1924 Solomon, Maynard: Beethoven. Schirmer Books, New York: 1998 (auf Englisch) Uhde, Jürgen: Beethovens Klaviermusik. Reclam, Stuttgart: 1984 |
||