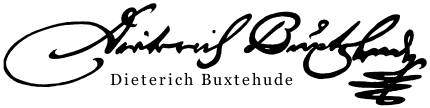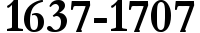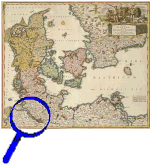|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
1637 |
Dieterich* Buxtehude wird geboren, wahrscheinlich in Helsingborg**, als Sohn des Johannes Buxtehude, Organist an der lutherischen Marienkirche, und seiner Ehefrau (über die wir nichts wissen). Dieterichs genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt, wie selbst das Jahr seiner Geburt nur errechnet und nicht belegt ist. Helsingborg ist eine wohlhabende dänische Stadt an der Ostküste des Øresund und wird etwas später zum Königreich Schweden gehören. Der Vater stammt aus Oldesloe (= Oldesloh, zwischen Lübeck und Hamburg im damals dänischen Herzogtum Holstein), die Mutter ist möglicherweise ebenfalls deutscher Abstammung.
* So schreibt er selbst seinen Vornamen. |
|
1641 |
Spätestens in diesem Jahr wird der als Musiker sehr angesehene Vater Organist an der Pfarrkirche St. Olai (= Olaf) in Helsingør, einer dänischen Stadt in Sichtweite von Helsingborg über den Øresund und nur 50 km nördlich von Kopenhagen (= Koppenhavn). Die Festung Kronborg über Helsingør ist Zollstation für alle Handelschiffe, die den Øresund passieren, und trägt zum Wohlstand der Stadt bei. Dieterichs Mutter muss früh verstorben sein; in diesem Jahr heiratet der Vater zum zweiten Mal, eine Dänin mit Namen Helle Jaspersdaatter. Über Dieterichs Kinderjahre weiss man kaum etwas. Es ist anzunehmen, dass er mit den Eltern deutsch wie auch dänisch spricht. Von ihm als Erwachsenem auf deutsch verfasste Dokumente bezeugen, dass er die Sprache völlig beherrscht. |
|
1643 |
Ab dem Alter von sechs Jahren besucht Dieterich wie die Kinder besser gestellter Familien in Helsingør die Lateinschule im ehemaligen Karmeliterkloster. Schon in der zweiten Klasse sind Singen und theoretischer Musikunterricht auf dem Stundenplan; zur Lehre der Musiktheorie wird das anspruchsvolle Heptachordum Danicum von Corvinus benutzt, ein in Latein verfasster Leitfaden. Die Schüler bilden den Kirchenchor und ziehen vor hohen Festtagen als Kurrende-Sänger durch die Stadt, um Almosen für die Armen zu erbeten. |
|
1645 |
Dieterichs Halb-Bruder Peter kommt zur Welt; aus dem Taufregister von St. Olai stammen einige der wenigen Hinweise auf die Familie Buxtehude. In späteren Jahren bekommen die Brüder noch mindestens zwei Schwestern, Katharina und Anna, aber deren Geburtsjahre sind nicht überliefert. |
|
1649 |
In diesem Jahr wird die grosse Orgel in der Olai-Kirche vom bekannten Kopenhagener Orgelbaumeister und Organist Johan Lorentz überholt und es wird vermutet, dass Vater Buxtehude bei dieser Gelegenheit seinen kleinen Dieterich bei Lorentz in die Lehre gibt. Dieterich wächst also in einer musikalisch reichen Umgebung auf, in der ausser der sakralen auch Theater- und Ballettmusik besonders geschätzt werden. Das ist wohl eine direkte Folge des Interesses der dänischen und schwedischen Königshäuser, die die besten Musiker aus Italien, Frankreich und Deutschland berufen. |
|
1657 |
Kein Dokument, keine Nachricht unterrichtet uns über den beruflichen Werdegang Dieterich Buxtehudes. In der Biographie von André Pirro (s.u.) wird die grosse Zahl der fähigen Komponisten und Organisten im norddeutschen Raum und vor allem in Hamburg erwähnt und es ist zu erwarten, dass ein junger Student ihre Namen kennt, vielleicht auch von den Besonderheiten ihrer Musik weiss. Darüber hinaus gibt es nur Vermutungen, ob und wo und wie lange er bei einem der grossen Orgelmusiker studiert. Aber jetzt, mit zwanzig Jahren, übt Dieterich selbst den Beruf des Organisten aus, an seiner ersten Stelle, der Marienkirche seines Geburtsorts Helsingborg. |
|
1658 |
In diesem Jahr, dem Ende des Nordischen Kriegs, muss Dänemark die Stadt Helsingborg und die umliegende Provinz Scania an das Königreich Schweden abtreten, aber der Friedensschluss von Röskild setzt den Feinseligkeiten beider Länder vorerst noch kein Ende. Glücklicherweise bleiben Dieterich in Helsingborg und die Familie seines Vaters jenseits des Sunds im dänischen Helsingør von den Kriegseinwirkungen relativ unbehelligt, auch von der in diesen Jahren wütenden Pest. |
|
1660 |
Dieterich Buxtehude wird zum Organist der Marienkirche in Helsingør ernannt; er ist damit der Nachfolger des nach Schleswig heimberufenen Klaus Dengel. Hier bezieht er etwa das dreifache Gehalt seiner Stelle in Helsingborg, sechzig Prozent mehr, als sein Vater ganz in der Nähe bei St. Olai verdient. Da das dem Organisten vorbehaltene Wohnhaus stark beschädigt ist, zieht Dieterich, noch unverheiratet, wieder zu seinen Eltern in das Haus in der Nähe der Kirche St. Olai. Er ist erst 23 Jahre alt aber schon als Musiker sehr geachtet: auf seinen Rat wird in den folgenden Jahren die Orgel an der Marienkirche mit beträchtlichen Kosten völlig überholt. Eine einzige von DBs Kompositionen stammt mit Sicherheit aus der Zeit in Helsingør, nämlich die Kantate Aperite mihi portas justitiae (BuxWV 7 *). * Die Nummerierung der Werke Buxtehudes folgt dem Verzeichnis von Georg Karstädt (s.u.) und ist nicht chronologisch. |
|
1667 |
Der Organist an der Marienkirche in Lübeck, Franz Tunder, stirbt im November am »hitzigen Fieber«. Dieterich Buxtehude bewirbt sich neben zwei anderen Kandidaten um die Stelle, gibt vor dem Magistrat im Dezember eine Probe seiner Kunst und ist erfolgreich. 
Lübeck: Marienkirche (erbaut zwischen 1250 und 1350), Zustand vor 1928.
|
|
1668 |
Am 11. April wird Dieterich Buxtehude offiziell als Organist der Marienkirche eingeführt, also wieder an einer Kirche, die der Hl. Maria geweiht ist. Die grosse Orgel ist ein besonders schönes Instrument und hat mit 3 Manualen und Pedal 54 klingende Register. Mit dieser Anstellung verdoppelt DB sein Gehalt gegenüber seinen Bezügen in Helsingør. 
Die grosse Orgel an der Westseite der Marienkirche zu Lübeck, eingerichtet 1516-1518, mit Erweiterungen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, die im Wesentlichen das Tonwerk betreffen ohne Änderung des Orgelprospekts.
Zustand vor 1932; 1942 bei einem Luftangriff zerstört. Kurz darauf leistet er den Bürgereid der Freien Kaiserlichen Reichsstadt Lübeck und wird damit zum Dienst in der Bürgerwehr verpflichtet. Die Stadt ist Mitglied der Hanse, einer starken Handelsverbindung von Städten, die zu einer internationalen Wirtschaftsmacht geworden ist. Allerdings verliert Lübeck jetzt etwas an Bedeutung mit dem allmählichen Niedergang der Hanse, bedingt u. a. durch den ständigen Kriegszustand in Nordeuropa, seit dem vergangenen Jahrhundert hauptsächlich auch zwischen Dänemark und Schweden. Die Stadt ist jetzt umgeben von schwedischem und dänischem Gebiet und daher müssen die Einwohner ständig auf der Wacht sein und ihre Befestigungen mit hohen Steuern gut in Schuss halten. Ein Zeitgenosse schreibt, die Bürger seien erzkonservativ, standesbewusst und fremdenfeindlich. Am 3. August heiratet Dieterich Buxtehude Anna Margaretha Tunder, die Tochter seines Amtsvorgängers Franz Tunder; sie ist zwei Jahre älter als der Bräutigam. Es ist nicht belegt, dass die Anstellung an der Marienkirche von der Eheschliessung abhing, obwohl dieses Art von Verbindung anscheinend der Brauch war; jedenfalls verpflichtet ihn die Kirchenbehörde zur Zahlung von etwa einem Drittel seines Gehalts für den Unterhalt der Schwiegermutter Tunder und ihrer beiden unverheirateten Töchter. In diesem Jahr wird der französische Komponist François Couperin geboren. |
|
1669 |
Das erste Kind von Anna und Dieterich Buxtehude kommt zur Welt, eine Tochter, die auf den Namen Magdalena Elisabeth getauft wird. Die Familien Buxtehude und Tunder kommen gut miteinander aus. Überhaupt ist Dieterich ein umgänglicher Mann, der sich auch mit den von der Stadt angestellten Ratsmusikern gut versteht. Er ist erfolgreich beim Sammeln von Spenden zur Aufführung grösserer musikalischer Werke und auf seine Anregung hin werden in der Marienkirche seitlich im Hauptschiff zwei Emporen gebaut, die Platz für zusätzliche, eventuell auswärtige Musiker und Sänger bieten. |
|
1670 |
Als Werkmeister der Marienkirche hat Buxtehude neben seinem Amt als Organist auch administrative Verpflichtungen, und da er in dieser Funktion sehr umsichtig ist, lassen ihm Konsistorium und Magistrat weitgehend freie Hand und unterzeichnen grosszügig seine Ausgaben für Instrumente, Noten und Honorare für Sänger und Musiker, die er zur Aufführung grösserer Werke engagiert. Zu den sieben von der Stadt beschäftigten Ratsmusikern kommen bei besonderen Anlässen noch bis zu drei Dutzend auswärtige Musiker dazu. Als erste uns überlieferte profane Komposition Dieterich Buxtehudes gilt sein Kanon Divertissons-nous auhourd’hui, beuvons, beuvons, beuvons (BuxWV 124), ein Eintrag in das Stammbuch eines angesehenen Bürgers. |
|
1671 |
Mit dem wachsenden Ruf Dieterich Buxtehudes werden natürlich mehr seiner Werke bekannt und kopiert (und uns damit erhalten), wie z. B. die sehr verbreitete Kantate Mit Fried und Freud ich fahr’ dahin (BuxWV 76). Langsam kann man eine Chronologie seiner Werke erstellen und die wichtigsten und bekanntesten seien deshalb an dieser Stelle erwähnt. Die zweite Tochter, Margaretha, kommt zur Welt. |
|
1672 |
Buxtehude schreibt die Arie Auf, stimmet die Saiten, Gott Phoebus tritt ein (BuxWV 116) zur Hochzeit des Lübecker Bürgermeisters. Anna Sophia wird geboren, die dritte Tochter von Anna Margaretha und Dieterich. |
|
1673 |
Zum ersten Mal nach dem Antsantritt Buxtehudes sind die sogenannten Abendmusiken an der Marienkirche wieder nachgewiesen, eine Serie von Konzerten zum Advent aber ausserhalb der Liturgie, an den fünf Sonntagen vor Weihnachten. Franz Tunder hatte diese Darbietungen in etwas anderem Format schon vor 1646 eingeführt; Dieterich Buxtehude setzt nun diese Tradition mit grossem Erfolg fort. Es sind, soweit das Programm bekannt ist, Konzerte grösseren Formats, deren Kosten bei geringem Eintrittsgeld weitgehend von den Handelsgesellschaften und den Zünften getragen werden. Lübeck und sein virtuoser Organist werden berühmt mit diesen Abendmusiken. |
|
1674 |
Dieterichs Vater stirbt im Alter von 72 Jahren und wird in der Marienkirche beigesetzt. Zu diesem traurigen Anlass wird die Kantate Fried- und freudenreiche Hinfahrt des alten grossgläubigen Simeons (BuxWV 76) zum ersten Mal aufgeführt, die DB drei Jahre zuvor komponiert hat. Dem jungen Organisten Johann Valentin Meder widmet Dieterich den vierstimmigen Canon duplex per augmentationem, BuxWV 123. |
|
1675 |
Die vierte Tochter kommt auf die Welt und erhält den Namen ihrer Mutter. |
|
1676 |
Zwei wichtige Werke Buxtehudes stammen aus dieser Zeit: zunächst die in italienischer Manier geschriebene Kantate Jesus dulcis memoria (BuxWV 57), von seinem Biographen Pirro ausführlich kommentiert, und dann eine sehr erfolgreiche Abendmusik, Die Hochzeit des Lamms (BuxWV 128), eigentlich ein Oratorium mit grosser Besetzung, von dem wir leider nur das von Buxtehude möglicherweise z. T. selbst verfasste Libretto haben. Die erste Aufführung des Oratoriums ist so aufwendig, dass Buxtehude die Kirche um Deckung des Defizits ersuchen muss. |
|
1677 |
Besonders eindrucksvoll ist das Trostlied M. Mauritii Rachelii, für einen Pastor aus Petersdorf (bei Rostock), der um den Tod seiner Gattin trauert (BuxWV 61). |
|
1678 |
Eine zweite Anna Sophia wird im August getauft, die fünfte Tochter. Die 1672 geborene Tochter gleichen Namens war verstorben. |
|
1680 |
Eine Serie von sieben Kantaten, deren jede sich auf einen Teil des Körpers Jesu Christi am Kreuz bezieht, entsteht in diesem Jahr. Buxtehude widmet Membra Jesu nostri, das Gesamtwerk (BuxWV 75), dem Kapellmeister am Hof des schwedischen Königs, Gustav Düben. Wir verdanken diesem Herrn, dass ein grosser Teil der Werke Buxtehudes noch erhalten ist. Zur Hochzeit des schwedischen Königs schreibt DB die Arie Klinget für Freuden, ihr lärmen Klarinen (BuxWV 119), wahrscheinlich auf Anregung von Gustav Düben, und schickt sie ihm nach Stockholm zur Aufführung. |
|
1681 |
Drei Kantaten Buxtehudes aus diesem Jahr sind in der Sammlung Düben in Tabulaturschrift* erhalten: Sicut Moses exaltavit serpentem (BuxWV 97), O dulcis Jesu, o amor cordis mei (BuxWV 83) und Gen Himmel zu dem Vater mein (BuxWV 32), neben anderen Werken, z. B. der längeren Hochzeitsarie Schlagt, Künstler, die Pauken und Saiten (BuxWV 122). Man darf daraus nicht unbedingt schliessen, dass Dieterich Buxtehude eine besonders produktive Phase erlebt, sondern eher, dass seine Musik beim Publikum und bei seinen Kollegen zunehmend Gefallen und Achtung, daher weitere Verbreitung durch Druck und handgeschriebene Kopien findet und erhalten bleibt. * Tabulatur ist eine Art von musikalischer Schrift, in der die Noten nicht wie in der heute gebräuchlichen Mensuralnotation auf Linien stehen, sondern in Buchstaben und Ziffern spezifisch für ein Instrument ausgedrückt sind. |
|
1683 |
Die Sammlung Düben in Uppsala/Schweden enthält eine ganze Reihe meist geistlicher Werke Buxtehudes, in diesem Jahr kopiert und daher wohl kurz zuvor entstanden, wie die Kantaten BuxWV 11, 48, 49 und die Motette BuxWV 113 für sechs Chöre. |
|
1685 |
Dieses ist das Geburtsjahr von Johann Sebastian Bach (* Eisenach) und von Georg Friedrich Händel (* Halle/Saale). DB widmet seinem berühmten Hamburger Kollegen Johann Adam Reincken (1623-1722) einen Canon quadruplex a 5 (BuxWV 124a) als »unsterblichen Ehren-Preiss«. |
|
1687 |
Dieterich Buxtehude stellt in einem Dank- und gleichzeitig Bittbrief an seine Gönner, den Vorstand der Zünfte von Handel und Gewerbe, mit Bedauern fest, dass die Kollekte für die Abendmusiken nicht mehr die nötigen Beträge einbringe. Seine als Werkmeister der Kirche geführten Wochenbücher (von denen wesentliche Auszüge in der Biographie von Snyder gegeben sind, s.u.) zeigen, dass Erhalt und Reparaturen der Orgel in der Marienkirche die Gemeinde jedes Jahr eine erhebliche Menge Geld kosten. Übrigens geht in diesem Jahr die einzige nachweisbare Reise Buxtehudes während seiner Tätigkeit in Lübeck nach Hamburg, um mit dem Orgelbauer Arp Schnitker den Zustand der Orgel in der Marienkirche zu besprechen und dessen neu renovierte Orgel in der Nikolai-Kirche zu »probieren«, wie aus einem Antrag zur Erstattung der Reisekosten und für vier Tage Aufenthalt in Hamburg hervorgeht. Während dieser Jahre erfreuen sich Buxtehude wie auch sein Kollege Adam Reincken in Hamburg vieler Besucher, nicht nur von Studenten sondern auch von erfahrenen Musikern, ein Zeugnis zur Kompositions- und Improvisationskunst dieser beiden norddeutschen Meister. Die freie Behandlung eines musikalischen Themas zumindest während der Wandlung war in der katholischen wie der protestantischen Liturgie schon seit etwa 1550 üblich. |
|
1688 |
Der verlorene Sohn (BuxWV 131), im Advent dieses Jahres aufgeführt, ist wie viele andere Werke Buxtehudes für seine Abendmusiken leider verschollen. Möglicherweise ist die Kantate O clemens, o mitis, o coelestis Pater (BuxWV 82) Teil dieser Abendmusik. Von der Gesamtzahl der Werke Buxtehudes sind bisher nur wenige mit Sicherheit zu datieren und daher ist die Meinung seines Biographen André Pirro (s.u.), dass die Produktivität des Komponisten von nun an nachlasse, schwer zu begründen. |
|
1689 |
Gustav Düben, der schwedische Hofkomponist, getreuer Freund Buxtehudes und Sammler seiner Werke, stirbt gegen Ende des Jahres. |
|
1694 |
Veröffentlichung von sieben Sonaten für Violine und Viola da Gamba mit Begleitung des Cembalo (erster Teil, BuxWV 252-258), bei Nikolaus Spiering in Hamburg. |
|
1695 |
Kantate Deh credete il vostro vanto (BuxWV 117) zur Hochzeit eines illustren Bürgers von Lübeck. |
|
1696 |
Veröffentlichung von sieben Sonaten für Violine und Viola da Gamba mit Begleitung des Cembalo, zweiter Teil (BuxWV 259-265). |
|
1698 |
Arie Opachi boschetti (BuxWV 121), komponiert zur Hochzeit eines Bürgermeisters. |
|
1699 |
Der Komponist und Organist Johann Pachelbel aus Nürnberg (* 1623) widmet Dieterich sein Hexachordum Apollinis, eine Sammlung von sechs Themen mit Variationen für die Orgel. Er möchte gerne seinen Sohn zum Studium bei DB schicken. |
|
1700 |
Für die Abendmusiken dieses Jahres ist ein reiches Programm vorgesehen, das mit vollen Texten schon im Januar dem Rat der Stadt und dem Konsistorium vorgelegt wird, wahrscheinlich mit der Bitte um Zustimmung und Gesuch der Finanzierung. Leider existieren weder Musik noch Text des Werks (BuxWV 133). |
|
1701 |
Im Protokoll eines Sitzung des Vorstands der Marienkirche wird erwähnt, dass Werkmeister Buxtehude sich über den Zustand der grossen Orgel beschwert habe, die » ... in 50, od: 60 Jahre und lengere nicht repariret, dieselbe aber voller Staub wehre und viele andere Mängell hette ... «. Diese Behauptung widerspricht den im Werkbuch über die Jahre hinweg von Buxtehude selbst eingetragenen Berichten von durchgeführten Reparaturen und deren Kosten. |
|
1703 |
Der 22-jährige Johann Mattheson aus Hamburg und der 18 Jahre alte Georg Friedrich Händel aus Halle, gute Freunde und beide talentierte und vielseitige Musker, kommen auf Einladung des Magistrats als mögliche Nachfolger des alternden Buxtehude nach Lübeck, um sich umzusehen, vorzustellen und vorzuspielen. Keiner der beiden jungen Meister will allerdings Buxtehudes Tochter, Jungfer Magdalena Elisabeth (* 1669), heiraten, die Bedingung zur Nachfolge im Amt. |
|
1705 |
Johann Sebastian Bach kommt gegen Ende Oktober aus Arnstadt zu Fuss nach Lübeck (eine Strecke von 450 km), um die Kunst Dieterich Buxtehudes vor allem bei seinen Abendmusiken zu » behorchen«. Das Konsistorium der Neuen Kirche in Arnstadt/Thüringen, an der JSB als Organist schon seit zwei Jahren angestellt ist, hat ihm dazu einen Urlaub von 4 Wochen genehmigt. Bach, ein junger Mann von 20 Jahren, ist in Arnstadt vergleichsweise sehr gut bezahlt und ist auch zufrieden mit der Wender-Orgel; es ist unwahrscheinlich, dass er die Absicht hat, sich um die Stelle Buxtehudes in Lübeck zu bewerben. Er weiss auch gewiss von vorneherein, dass er mit der ihm zugestandenen Reisezeit nicht auskommen werde. Jedenfalls kommt er erst am 7. Februar 1706 wieder zurück nach Arnstadt und muss sich vor dem Konsistorium wegen der eigenmächtigen, überlangen Ausdehnung seines Arbeitsurlaubs verantworten. Er geniesst allerdings schon einen solchen Respekt als Künstler, dass die Exkursion keine weiteren Folgen für seine Anstellung hat.* * Ein interessantes Kapitel zur Reise Johann Sebastian Bachs nach Lübeck und den Einfluss Buxtehudes auf seine Musik findet sich in der grossen Bach-Biographie von Philipp Spitta (Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1873, 4. Auflage von 1930, Bd. I, p. 258 ff). [Im Jahre 2005 wurden von den Leipziger Musikwissenschaftlern Michael Maul und Peter Wollny im Bestand der Herzogin Amalia-Bibliothek zu Weimar einige Faszikel mit Chorälen in Tabulaturnotation gefunden*, darunter einer mit dem Choral Nun freut euch, lieben Christen g’mein von Dieterich Buxtehude, zweifellos kopiert vom etwa 13-jährigen Johann Sebastian Bach. Wir sehen, dass der junge Bach schon zu der Zeit, als er bei seinem Bruder in Ohrdruf wohnte, Werke des grossen Lübecker Organisten kannte und schätzte. Michael Maul, Peter Wollny, Hrsg.: Weimarer Orgeltabulatur. Bärenreiter-Verlag, Kassel: 2007] Zum Tode von Kaiser Leopold I wird in Lübeck, der Freien Kaiserlichen Reichsstadt, Buxtehudes Oratorium Castrum doloris (= Leidenslager, BuxWV 134) als Abendkonzert mit grossem Pomp in St. Marien aufgeführt. Die Musik dazu ist nicht überliefert. Am nächsten Tag folgt das kleinere Werk Templum honoris (= Ehrentempel, BuxWV 135), wahrscheinlch eine Glückwunschkantate zur Thronbesteigung von Kaiser Joseph I. Leider sind von diesem Werk weder Text noch Musik erhalten. Die letzte uns bekannte Komposition Dieterich Buxtehudes ist die Ariette O fröhliche Stunden, o herrlicher Tag (BuxWV 120) zur Hochzeitsfeier eines Lübecker Bürgermeisters. |
|
1706 |
Almira, die erste Oper Georg Friedrich Händels, kommt in Hamburg zur Uraufführung. Der Komponist und Organist Johann Pachelbel (* 1653) stirbt. |
|
1707 |
Tod von Dieterich Buxtehude am 9. Mai im Alter von 70 Jahren. Die Todesursache ist nicht bekannt. Er wird in der Marienkirche Lübecks beigesetzt. Von den Töchtern der Buxtehude überleben nur drei den Vater. Anna und Dieterich haben keine Söhne. Im Juni wird Johann Christian Schieferdecker zum Nachfolger Dieterichs berufen; kurz darauf heiratet er Buxtehudes Tochter Anna Margaretha. |
|
1722 |
Johann Adam Reincken wird auf seinen testamentarischen Wunsch neben dem »einzig würdigen« Dieterich Buxtehude in der Marienkirche beigesetzt. |
|
|
Die über der Biographie stehende Ansicht der Stadt Lübeck stammt von Matthäus Merian (1593-1669) aus dem Jahr 1641. Auf der kleinen Anhöhe im Zentrum der Stadt steht die doppeltürmige Kirche St. Marien, erbaut zwischen 1250 und 1350. Hier war Dieterich Buxtehude von 1668 bis zu seinem Tode am 9. Mai 1707 als Organist tätig. |
||

Lübeck: St. Marien, Rathaus und Altstadt nach den Zerstörungen durch den Luftangriff vom 29.3.1942. Photograph unbekannt. Bild-Archiv Marburg: www.bildindex.de
|
||
Empfohlene Literatur |
||
|
|
Georg Karstädt: Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Dietrich Buxtehude. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden: 1985 Hans Joachim Moser: Dietrich Buxtehude. Verlag Merseburger, Berlin: 1957 André Pirro: Dietrich Buxtehude. Librairie Fischbacher, Paris: 1913. Nachdruck: Minkoff Reprint, Genève: 1976 (auf Französisch) Kerala J. Snyder: Dieterich Buxtehude. Leben, Werk, Aufführungspraxis. Bärenreiter-Verlag, Kassel: 2007 (Übersetzung der auf Englisch verfassten Biographie, neu bearbeitet) |
|

|
Klicken Sie hier, um Dieterich Buxtehudes Suite in A-Dur für Klavier, BuxWV 243, zu hören, mit den Sätzen
Allemande, Courante, Sarabande und Gigue. |
|
|
Ich bedanke mich freundlichst bei den Damen und Herren der Stadtbibliothek Lübeck für ihre Hilfe bei der Suche nach den Werken Dieterich Buxtehudes.
|
||